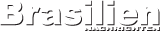Ein Neuanfang ist gemacht
Bernd Lobgesang
Das Neueste gleich zu Beginn: Zum ersten Mal seit über vier Jahren wurden wieder Reservate ausgewiesen - und das gleich für mehrere indianische Völker. Staatspräsident Lula da Silva unterschrieb am 29. April die dafür notwendigen Dekrete, durch die sechs neue Reservate in verschiedenen Landesteilen entstehen....
Das Neueste gleich zu Beginn: Zum ersten Mal seit über vier Jahren wurden wieder Reservate ausgewiesen - und das gleich für mehrere indianische Völker. Staatspräsident Lula da Silva unterschrieb am 29. April die dafür notwendigen Dekrete, durch die sechs neue Reservate in verschiedenen Landesteilen entstehen. „Heute habe ich die Freude, die offizielle Genehmigung von sechs indigenen Territorien zu unterzeichnen“, schrieb Lula auf Twitter und bescherte damit einem jährlich stattfindenden indianischen Protestcamp, zu dem diesmal etwa 6.000 Ureinwohner aus allen Landesteilen in Brasília zusammengekommen waren, einen geradezu triumphalen Abschluss. Zwei dieser neuen Reservate, die insgesamt mehr als 6.000 km² umfassen, befinden sich im Amazonasgebiet, zwei weitere liegen im Nordosten, die beiden letzten in den Bundesstaaten Goiás und Rio Grande do Sul. Mit dieser Maßnahme des Präsidenten steigt die Zahl der Indianerreservate in Brasilien auf 732. Sie machen 13,8 der Staatsoberfläche aus. Das sagt allerdings nicht so viel aus, da in vielen dieser Schutzgebiete Eindringlinge der verschiedensten Couleur vorzufinden sind, unter ihnen Großgrundbesitzer, Kleinbauern, Goldsucher und Holzfäller. Aber immerhin: Der neue Präsident macht Dampf und liefert auch eine passende Erklärung für die Schnelligkeit seiner Reformen: Wenn er, so wie er es im Wahlkampf versprochen hat, die Zerstörungen im amazonischen Regenwald bis zum Jahr 2030 auf Null zurückfahren will, braucht er die Hilfe der Ureinwohner. Das weiß er ganz genau. Auf das in diesem Zusammenhang immer wieder zu hörende Argument, die Indigenen würden viel zu viel Land für sich beanspruchen, erwidert der Staatspräsident seinen Kritikern: „Wenn es heißt, dass sie 14% der Landesfläche beanspruchen und dass das viel ist, müssen Sie bedenken, dass sie vor der Ankunft der Portugiesen 100% beansprucht haben.“
Neue Gesichter – neue Politik
Lula macht es ernst. Mit Sônia Guajajara ernannte er eine der profiliertesten Personen des indianischen Brasiliens zur Chefin des neu entstandenen Ministeriums für indigene Völker. Ähnlich pointiert verfuhr er bei der Besetzung des obersten Postens im „Ministerium für die Gleichstellung ethnischer Gruppen“. Er ernannte Anielle Franco zur Ministerin. Sie ist die Schwester der prominenten Frauen- und LGTBIQ-Aktivistin Marielle Franco, die 2018 in Rio de Janeiro unter reichlich mysteriösen Umständen zusammen mit ihrem Chauffeur auf offener Straße ermordet wurde. Der feige Mord erhält dadurch eine besondere Brisanz, da nicht auszuschließen ist, dass die Familie des damaligen Staatspräsidenten Bolsonaro mit in das Verbrechen verwickelt war. Die 36-jährige afrobrasilianische Franco wuchs in der Favela Maré in Rio de Janeiro auf. Sie studierte dank einiger Stipendien Journalismus in den USA, bevor sie dann in ihrem Heimatland zu den ersten „Quotenstudierenden“ gehörte.
Die 48-jährige Sônia Bone de Souza Silva vom Volk der Guajajara ist die erste indianische Ministerin überhaupt in der brasilianischen Geschichte. Sie studierte Pädagogik und war u.a. Koordinatorin der „Organisation der Indigenen Völker Brasiliens“ (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). Vom „Time Magazine“ wurde sie 2022 in die Liste der weltweit einflussreichsten Menschen aufgenommen. Die Ernennung dieser beiden Frauen zu Ministerinnen ist ein nicht zu unterschätzendes historisches Ereignis, denn mit ihnen gelangen gleich zwei Vertreterinnen der in Brasilien am stärksten unterdrückten Gruppen, der Ureinwohner und der Afrobrasilianer, an die Hebel der politischen Macht. Dass es sich bei ihnen um Frauen handelt, verstärkt noch zusätzlich den Eindruck, dass in Brasilien hoffentlich eine neue Zeit angebrochen ist. Beide repräsentieren - zumindest theoretisch - an die 55 Prozent der brasilianischen Gesamtbevölkerung, zu der neben den indianischen Nationen und den Afrobrasilianern viele weitere ethnische Gruppen wie Caboclos und Cafuzos gehören. Alle diese Gruppierungen werden auf vielfältige Weise aufgrund ihrer Herkunft, Sprache, Hautfarbe, Religionen und Traditionen in den Schulen und an den Universitäten, im Berufsleben und in der Politik benachteiligt. Oft schlägt ihnen auch ein massiver Rassismus entgegen. Sie haben es wesentlich schwerer als ihre hellhäutigen Landsleute, einen Zugang zur Bildung und zur beruflichen Ausbildung zu finden. Viel öfter als diese werden sie Opfer von polizeilichen Razzien, die nicht selten tödlich enden, insbesondere dann, wenn sie in den Favelas der Großstädte stattfinden.
Das nunmehr wiederbelebte Ministerium für die Gleichstellung der ethnischen Gruppen (Ministério da Igualdade Racial, MIR) soll sich für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der ethnischen Gleichstellung, insbesondere der schwarzen Bevölkerung, und zur Bekämpfung des Rassismus auf nationaler Ebene kümmern. Während der Zeremonie der Ernennung der beiden Ministerinnen unterschrieb Präsident Lula da Silva ein frisch verabschiedetes Gesetz, das rassistische Äußerungen mit dem Strafbestand des Rassismus gleichsetzt. Franco erinnerte in ihrer Ansprache an den Sturm auf den Präsidentenpalast am 8. Januar und stellte damit eine Querverbindung zu dem neuen Gesetz her: „Nach den Angriffen, denen dieses Haus und das brasilianische Volk am vergangenen Sonntag ausgesetzt waren, setzen wir hier ein Zeichen des Widerstands gegen alle Versuche, die Institutionen und unsere Demokratie anzugreifen. Faschismus ist ebenso wie Rassismus ein Übel, das in unserer Gesellschaft bekämpft werden muss.“
Land ist Leben
Der Unterschied zwischen der Regierungszeit von Präsident Bolsonaro (2019-2023) und seinem Nachfolger Lula da Silva könnte kaum gravierender sein. Während Bolsonaro schon während des Wahlkampfs verlautbaren ließ, dass er keinen weiteren Zentimeter Land mehr für die Indigenen anerkennen würde, rief Lula schon vor wenigen Wochen während einer Versammlung von Kaziken in Roraima das Ministerium für Indigene dazu auf, „so schnell wie möglich“ alle Gebiete ausfindig zu machen und ihm zu nennen, die als Reservate anerkannt werden sollten. Diese Regionen müssten sofort demarkiert werden, bevor sie in die Hände anderer fallen könnten, „indem sie Dokumente fälschen“. Lula weiß, dass die rasche Anerkennung von weiteren indianischen Landansprüchen beim Kampf gegen den Klimawandel und die Entwaldung hilft. Und hat mit dieser Einschätzung Ministerin Sônia Guajajara fest auf seiner Seite. Sie hat bereits 14 weitere Territorien mit einer Gesamtfläche von fast 9.000 km² zur offiziellen Anerkennung als Reservate vorbereitet: „Wir werden zum Wohle der gesamten Menschheit eine neue Geschichte unseres Planeten schreiben“, erklärte die Ministerin nicht ohne Pathos, nachdem sie die Unterschrift unter die entsprechenden Dekrete geleistet hatte.
Mit dieser Politik der raschen Anerkennung von Reservaten schlägt der Präsident zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits erfüllt er sein im Wahlkampf immer wieder geäußertes Versprechen, die Lage der Ureinwohner zu verbessern, und andererseits stellt er damit sein ehrgeiziges Programm zur Verringerung der Regenwaldverluste auf eine stabilere Basis. Alle wissenschaftlichen Studien weisen darauf hin, dass der Regenwald nirgendwo in Brasilien so intakt und unversehrt ist als in den Siedlungsgebieten von autochthonen Gruppen und insbesondere der Ureinwohner. Der Schutz der Indigenen geht also Hand in Hand mit der Bewahrung der Natur. Wer einmal in Amazonien gewesen ist, wird diese Tatsache bestätigen können: Dort kann man unter Umständen mit dem Überlandbus stundenlang durch kahle Landschaften mit schütterer Vegetation fahren. Dann kann es passieren, dass die Straße urplötzlich durch dichte, dunkle Wälder führt. Wenn der Bus nicht klimatisiert ist, sinkt augenblicklich die Temperatur und die Luft wird feuchter. Genauso schnell und radikal aber kann sich die Szenerie irgendwann später wieder verändern. Die Schatten spendenden Bäume verschwinden und machen wieder einer Steppe Platz, die von Termitenhügeln übersät ist und auf der wenige, mehr oder weniger magere Rinder weiden. Die Erklärung für dieses Phänomen findet sich rasch: Der Bus ist durch ein Indianerreservat gefahren.
Einschränkend muss man allerdings zugeben, dass die Indigenen leider nicht immer und überall in der Lage sind, so effizient für die Erhaltung der Natur zu sorgen, da der von Großgrundbesitzern, Großfarmern, Goldsuchern, Holzfällern, Bodenspekulanten und auch Kleinbauern ausgehende Druck auf die indianischen Territorien groß ist und beständig wächst. Die nach Angaben des Nationalen Instituts für Geographie und Statistik (IBGE) über 1,6 Millionen Individuen und 266 Völker umfassende indianische Minderheit hat in den vergangenen Jahren enorm an Selbstbewusstsein und Ausdrucksfähigkeit gewonnen. Sie ist national und international gut vernetzt, selbst modernste Technologie kommt in nicht wenigen Reservaten immer öfter zum Einsatz. Aber das alles wird nicht ausreichen, um die Existenz der Indigenen und der für die gesamte Menschheit so wichtigen Regenwälder zu garantieren. In Brasilien müssen den Indianern eine für Menschenrechte und Natur sensibilisierte nationale Öffentlichkeit, eine investigative, unabhängige Presse sowie ein demokratisch legitimierter, durchsetzungsfähiger Staat, der die ihm durch die Verfassung von 1988 auferlegten Verpflichtungen wahrnimmt, zur Seite stehen.
Herkulesaufgaben stehen an
Lula will, wie bereits erwähnt, bis 2030 die Verluste an Regenwald in Brasilien auf Null herunterfahren. Zwar hat es in dieser Beziehung während der beiden ersten Legislaturperioden des sozialdemokratischen Präsidenten schon große Erfolge gegeben, aber trotzdem verfolgt diese Ankündigung ein sehr ehrgeiziges Ziel. Schon 2003, als Lula im Januar die Regierungsgeschäfte übernahm, hatte sich überdeutlich gezeigt, wie schwierig es werden würde, eine naturfreundliche Politik durchzusetzen. Auch nach Lulas Machtübernahme blieben damals die Abholzungsquoten monatelang hoch, ja mehr noch, sie waren höher als unter der Vorgängerregierung. Das war die Folge mangelnder Überwachung Amazoniens durch die neue Regierung, die von Großgrundbesitzern und Viehzüchtern ausgenutzt wurde, um noch so schnell wie möglich Regenwald in Viehweiden und Plantagen umzuwandeln. Auch heute sieht es prinzipiell nicht sehr viel anders aus: Während der Regenwaldverlust im Januar zurückging, schnellte er ab Februar wieder in die Höhe. Bereits jetzt sind nach Angaben von Experten 18% des brasilianischen Teils des Amazonaswaldes gerodet. Bei 20% bis 25% wird mit einem Kipppunkt gerechnet, der dazu führen wird, dass die 75% noch intakten Waldflächen nicht überleben können. Eine massive Versteppung wäre die Folge. Würde damit Amazonien als großer Speicher von Kohlendioxid ausfallen, wäre das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, absolut illusorisch.
Neue Gefahren für den Regenwald gehen nun zusätzlich von dem Freihandelsabkommen aus, das zwischen den Mercosur-Staaten, zu denen Brasilien gehört, und der Europäischen Union geplant ist. Es wird den Export von Soja, Fleisch und anderen Produkten der Landwirtschaft vorantreiben. Und das bedeutet bei den derzeitigen Machtverhältnissen, dass noch mehr Flächen Regenwald und Cerrado verschwinden. Als im März Wirtschaftsminister Robert Habeck in Amazonien zu Besuch war, beteuerte er zwar, dass ein erweiterter Handel auf keinen Fall zu einer erhöhten Abholzung führen dürfe, es muss aber die bange Frage gestellt werden, ob diesen Worten auch wirklich die entsprechenden Taten folgen werden.
Völkermord an den Yanomami
Augenblicklich geht es darum, nicht nur die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen, sondern auch die schlimmsten Schäden der vergangenen Legislaturperiode einigermaßen in den griff zu bekommen. Nach vier Jahren Laissez-faire im Umweltschutzbereich und beim Schutz der indigenen Völker müssen in allen Regionen des Landes tiefe Wunden, die diese Politik gerissen hat, rasch behandelt werden. In kaum einer anderen Region als im Indianerreservat der Yanomami hinterließ die genozidale Politik von Präsident Bolsonaro tiefere Narben. Heute leben dort nicht nur etwa 30.000 Yanomami, sondern auch um die 20.000 Goldsucher, die in Brasilien Garimpeiros genannt werden, halten sich dort illegalerweise auf. 1992 nur eine Woche vor der Umweltschutzkonferenz in Rio de Janeiro in einer überraschenden PR-Aktion von dem damaligen Präsidenten Collor aus dem Boden gestampft, handelt es sich bei einer Fläche von der zweieinhalbfachen Größe der Schweiz um das größte geschlossene Indianergebiet auf brasilianischem Boden. Es befindet sich vor allem in dem an der Grenze zu Venezuela gelegenen Bundesstaat Roraima. Die brasilianische Regierung und ihre ausführenden Organe haben in nicht wenigen Teilen dieses immer noch weitgehend mit dichtem Wald bedeckten Gebietes jegliche Kontrolle verloren. An ihre Stelle sind Goldsucher und Drogenhändler getreten. Oft befinden sich die Schürfgebiete der Garimpeiros in unmittelbarer Nähe der indianischen Dörfer. Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und Syphilis nahmen in den letzten Jahren sprunghaft zu, ebenso die Prostitution. Da die Goldsucher durch Rodungen, Sprengungen und Maschinenlärm das Wild verjagen und die Flüsse durch den Einsatz von Quecksilber vergiften, verschlechterte sich die Ernährungslage der Yanomami dramatisch. Während der Regierungszeit Nach Angaben verschiedener Indianerorganisationen verstarben von 2019-2022 etwa 600 Kinder an den verschiedensten behandelbaren Krankheiten sowie an Unterernährung. „Wenn mir jemand gesagt hätte, dass die Menschen hier in Roraima so unmenschlich behandelt werden, wie ich es bei den Yanomami gesehen habe, ich hätte es nicht geglaubt“, erklärte Lula bei einem Blitzbesuch im dortigen Reservat, nur wenige Tage nachdem er offiziell die Regierungsgeschäfte in Brasília übernommen hatte. Als Sofortmaßnahme verhängte der Präsident den Gesundheitsnotstand über das gesamte Reservat.
Und tatsächlich: Die Bilder, die Fernsehen und Presse aus dem Reservat und den Krankenhäusern übermittelten, schockieren zutiefst. Sie zeigen bis zum Skelett abgemagerte Kinder und alte Leute, die sich wegen ihrer Schwäche nicht mehr auf den Beinen halten können. Mehr als die Hälfte der Kinder der Yanomami leiden an schwerer Unterernährung, in abgelegenen Gebieten sind es sogar 80% der unter Vierjährigen. Fast alle sind malariakrank, nicht wenige werden zudem von Durchfall, Atemwegserkrankungen oder Tuberkulose geplagt. Auch ältere Erwachsene und viele Mütter gehören zu den besonders oft Erkrankten und Hilfsbedürftigen.
Bolsonaro bald vor Gericht?
Piloten der Luftwaffe überfliegen jetzt regelmäßig das Reservat. Mit ihnen sind Beamte der Gesundheitsbehörde unterwegs, die Lebensmittel abwerfen und kranke und hungernde Bewohner nach Boa Vista in die Hospitäler bringen.
Für diese dramatische Situation ist einzig und allein die Regierung Bolsonaro (2019-22) verantwortlich. Während der Corona-Pandemie blockierte sie systematisch Lieferungen von Medikamenten, Lebensmitteln und Hilfsgütern in das Reservat. Die damalige Ministerin für Menschenrechte versuchte sich damit herauszureden, indem sie behauptete, die Indigenen hätten erst befragt werden müssen, ob sie die Hilfsgüter wirklich wollten. Das Malariamittel Chloroquin, das der Staatspräsident fälschlicherweise nicht müde wurde, als Allerheilmittel gegen Corona anzupreisen, gelangte bezeichnenderweise nicht ins Gebiet der Yanomami, obwohl gerade sie von Malaria heimgesucht wurden. In seinem vorübergehenden Exil in Florida erklärte er im Januar 2023, die Yanomami hätten bei seinem letzten Besuch in der Region nur den Zugang zum Internet gefordert. So etwas kann man wohl nur als bewusste Verdrängung der Realität bezeichnen.
Die brasilianische Staatsanwaltschaft nahm inzwischen Ermittlungen auf, da der Verdacht besteht, dass viele für die Indianer ursprünglich bestimmte Hilfsgüter und Medikamente aufgrund der grassierenden Korruption in anderen Kanälen verschwanden. 21 Anzeigen wegen im Reservat operierender Goldsucher ließen die vorherige Regierung völlig kalt. Zwei notorischen Goldschmugglerorganisationen gewährte sie dagegen Konzessionsrechte für den Bergbau nur wenige Kilometer von den Außengrenzen des Reservats entfernt.
Bolsonaro muss nun damit rechnen, dass er wegen seiner bewussten und offensichtlichen Unterlassung von Hilfeleistung gerichtlich zur Verantwortung gezogen wird. Aus seiner Verachtung für die Ureinwohner hat er ja nie einen Hehl gemacht. So erklärte er 2018 im Kongress den Genozid an den nordamerikanischen Indianervölkern als vorbildhafte Aktion. Die US-Kavallerie habe ein für alle Mal das Problem gelöst. Direkt nach seinem Amtsantritt dünnte er die FUNAI, die staatliche Indianerschutzbehörde, radikal aus und setzte in wichtige Positionen unerfahrene und inkompetente Polizeibeamte und Militärs ein. Bei Lulas Regierungsantritt wurde zudem deutlich, dass es in der FUNAI mehr offene als besetzte Stellen gab. Das muss zur Folge haben, dass diese Behörde durch Neueinstellungen erst wieder funktionsfähig gemacht wird.
Ein neuer Wind weht in Brasília
Dass nach vier Jahren Stagnation ein neuer Wind in der Hauptstadt weht, drückt sich auch darin aus, dass die vielfältigen Stimmen der Ureinwohner auf einmal auch im Kongress Gehör finden. So hielt sich zum Beispiel Ende März eine Delegation von mehr als 100 indigenen Führungspersönlichkeiten im Abgeordnetenhaus auf. Sie forderten in ihren Reden im Parlament die sofortige Aufhebung von immer noch anhängigen Gesetzesvorschlägen, die sich frontal gegen die Interessen der Ureinwohner richten. Diese Gesetzesvorlagen wollen zum Beispiel den Abbau von Bodenschätzen auf indigenem Territorium oder die Ausweitung der Vieh- und Landwirtschaft in bisher noch unberührten Regionen erreichen. Die in Brasília versammelten Männer und Frauen stammten aus allen Landesteilen Brasiliens, so etwa aus der Überschwemmungsregion des Pantanal, aus den Savannen des Cerrado, aus Amazonien, aus der Pampa ganz im Süden des Landes und aus der Trockenregion der Caatinga im Nordosten.
Das zentrale Anliegen bei den Verhandlungen und Gesprächen war der sogenannte Marco Temporal. Gemeint ist damit ein beim Obersten Gerichtshof (STF) anhängiges Verfahren, bei dem es seit September 2021 zu keiner Entscheidung gekommen ist. Die „Zeitmarke 1988“ besagt, dass nur die Gebiete als Reservate anerkannt werden dürfen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verfassung am 5. Oktober 1985 von indigenen Völkern bewohnt wurden. Rosa Weber, die jetzige Präsidentin des STF, versprach, das Thema im ersten Semester dieses Jahres wieder aufzugreifen und abschließend zu verhandeln. Sollte der STF den Marco Temporal anerkennen, würde das die Politik der jetzigen Regierung erheblich erschweren, denn viele Ureinwohner waren gerade während der Zeit der Militärdiktatur (1964-85) vertrieben worden und lebten zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Verfassung nicht mehr auf ihrem angestammten Territorium. Viele Völker konnten erst danach ihre Gebiete oder zumindest Teile davon zurückerobern. Die Anerkennung der Marco Temporal wäre ein großer Sieg der Agrarlobby gegen die Rechte der indigenen Völker. Das weiß jeder im Land. „Der Feind der indianischen Völker schläft nicht. Wir müssen deshalb immer aufmerksam, immer wachsam sein. Wir bitten die Abgeordneten, sich mit uns zusammenzuschließen“, meinte deshalb Cássio Júnio, Kazike der Xukuru-Kariri bei seinem Auftritt im Parlament. Und Maria Gabriela Pinheiro vom Volk der Kariri-Xokó ergänzte: „Es gibt viele Gesetzesvorschläge, denen wir uns entgegenstellen müssen und die wir abschmettern müssen. Das Geld spielt in diesem Land eine große Rolle, aber die Kraft unserer Herkunft bleibt bestehen. Unsere Bundesstaaten müssen die von uns ausgehende Kraft der indianischen Energie spüren.“
Der Abgeordnete Aírton Faleiro von der Partei der Arbeiter (PT) wies darauf hin, dass die Lage jetzt sehr viel besser sei als in den vergangenen vier Jahren. Jetzt müsse eine starke Verbindung zwischen den indigenen Organisationen, dem Parlament und der Bundesregierung hergestellt werden. Auch CIMI-Sekretär Luís Ventura rief zu einer Bündelung der gemeinsamen Kräfte auf: „Wir müssen diese vier Jahre nutzen, um voranzukommen. Es wird aber nicht leicht werden. Wir müssen strategisch denken. Wir haben es mit einer Regierung zu tun, die uns sehr zufrieden macht und erfreut. Aber sie ist in Bedrängnis und wir werden mit ihr streiten müssen.“
Ausgabe BrasilienNachrichten Nr.167/2023