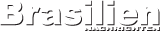Agrarreform in weiter Ferne
Das Assentamento (Landlosensiedlung) Ipanema in der Nähe der Stadt Sorocaba im Bundesland São Paulo hat es nach neunzehn Jahren geschafft. Viele der 151 Landarbeiterfamilien erreichten es, dass sich ihre Lebensumstände seit der Landbesetzung 1992 in den letzten Jahren verbesserten.
Dazu trug auch die enge Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung in Iperó bei. Die Vermarktung der oft biologisch erzeugten landwirtschaftlichen Produkte geschieht weitgehend ohne Zwischenhändler und sichert so den Familien ein besseres Einkommen. Mit Hilfe der Stadtverwaltung Iperós gelang es, der Bevölkerung den Wert unbehandelter Lebensmittel nahe zu bringen. Jedoch: Die von der Landlosenbewegung initiierte Besetzung führte nicht zur Zusammenarbeit in einer Kooperative. Die meisten Landarbeiterfamilien arbeiten heute individuell. Nur die Vermarktung geschieht teilweise gemeinsam. Trotz aller Einschränkungen sieht der PT-Landtagsabgeordnete Hamilton Pereira die Entwicklung des Assentamentos Ipanema als eine Erfolgsgeschichte an: „Heute lässt sich sagen, dass Ipanema ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Besetzung ist. Ipanema zeigt, dass eine Agrarreform möglich und grundlegend für die Entwicklung unseres Landes ist.“
Es ist eine Schande, dass es in einem Land, das im vergangenen Jahr 149,5 Millionen t Getreide, Hülsenfrüchte wie auch Ölpflanzen produziert hat, immer noch Menschen gibt, die Hunger leiden“
Dilma Rousseff, 11.2.2011
Landbesetzungen rückläufig
Ipanema ist eine Ausnahme. Vor acht Jahren trat die Lula-Regierung mit dem Ziel an, eine echte Agrarreform durchzuführen. Zur Erinnerung: In Brasilien besitzen 1 % der Bevölkerung ca. 44% der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. Am Ende der Amtszeit Lulas ergibt sich ein sehr ernüchterndes Bild. 2010, das letzte Regierungsjahr, war hierbei laut Landarbeiterpastoral CPT (Comissão Pastoral da Terra) sogar das schlimmste. Die Zahl der angesiedelten Familien verringerte sich gegenüber dem Vorjahr erheblich (siehe Grafik S. 16), die Zahl der Landbesetzungen ging auf 180 zurück (2009: 290; 2008: 252). Glaubt man offiziellen Regierungsangaben kam es zwischen 2003 und 2010 zur Ansiedlung von 614.000 Familien in 3.551 assentamentos (Agrarsiedlungen). Das ursprüngliche Ziel, die jährliche Ansiedlung von 100.000 Familien, wird jedoch auch bei dieser Zählweise, bei der die rechtliche Anerkennung bereits bestehender Siedlungen mit eingerechnet wird, nicht erreicht. CPT und Landlosenbewegung MST (Movimento dos Sem Terra) gehen davon aus, dass in Wirklichkeit während der vergangenen acht Regierungsjahre nur 377.847 Familien (DataLuta: Banco de Dados da Luta pela Terra 2011) eine neue, ständige Bleibe fanden.
Agroindustrie versus kleinbäuerliche Familienbetriebe
Die alte Frage, ob insbesondere die Agroindustrie mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden soll oder ob die Förderung kleinbäuerlicher Strukturen wichtiger sei, scheint sich heute anscheinend gar nicht mehr zu stellen. Zu klar sind die Fakten: Brasilien ist Weltmarktführer beim Export von Soja und dem Agrotreibstoff Ethanol. Regierungsgelder gehen massiv in die Ethanolproduktion, deren Grundlage Zuckerrohr ist. Die Viehwirtschaft breitet sich extensiv aus, bereits jetzt erkennbare, negative Folgen bleiben schlicht außer Acht: „Es gibt ja genügend Fläche.“ Wie falsch dieses Denken ist, zeigen die verheerenden Überschwemmungen Mitte 2010 in den Nordostbundesländern Alagoas und Pernambuco. Dutzende von Städten waren davon betroffen. Wissenschaftler sind sich einig, dass diese Katastrophe ihre Ursache in der dort vorherrschenden Monokultur des Zuckerrohranbaus hat.
Nicht nur die Agroindustrie, sondern auch die geplanten und zum Teil bereits in Angriff genommenen Großprojekte werden in den nächsten Jahren den Nordosten und die Lebenswirklichkeit unzähliger Familien verändern. Die Ableitung des Rio São Francisco (wir berichteten bereits des öfteren darüber), großflächig bewässerte Obstplantagen, ebenfalls mit staatlichen Gelder geförderte, neu angelegte Bewässerungssysteme kommen hauptsächlich Großunternehmen zugute. Selbst wenn in diesen Projekten, wie von der Agroindustrie gerne behauptet, einige Arbeitsplätze entstehen, der Verlust an Arbeitsplätzen durch den Einsatz von Maschinen überwiegt letztendlich doch. Die Zahlen des IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Brasilianisches Institut für Geographie und Statistik) für den Bundesstaat Mato Grosso do Sul zeigen beispielhaft, dass die Zahl der Beschäftigten im Agrobereich dort aufgrund der wachsenden Mechanisierung von 97.654 (1995/96) auf 75.083 im Jahr 2006 fiel.
Wirtschaftsaufschwung blockiert Mobilisierung
Die Situation im Agrarbereich zwingt Abertausende von Familien ihr Glück und ihr Auskommen in einer der großen Städte zu suchen. Dort bleibt ihnen aufgrund ihres geringen Bildungsniveaus oftmals nur eine Arbeit im Baubereich. Diese schon vor Jahren in die Stadt Gezogenen bildeten bisher das Rückgrat der Landbesetzungen, die von der Landlosenbewegung MST organisiert wurden. In letzter Zeit veränderte sich die Lage, und die Mobilisierung gelingt nur noch schwer.
Gilmar Mauro, Mitglied des Führungsgremiums des MST, ist sich dessen bewusst. „Die sozioökonomische Situation im Land hat sich verändert.“ So sind in den letzten Jahren sichere Arbeitsplätze, vor allem im Baugewerbe, entstanden, 30 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer gelang der Aufstieg in die untere Mittelschicht. Gerade der Boom im Baugewerbe gibt vielen Ex-Landarbeitern ein Auskommen in der Stadt. Sie sind deshalb nicht mehr daran interessiert, auf das Land zurückzukehren. Hinzu kommt mit dem Sozialprogramm Bolsa Família ein Programm, das sich die Armutsbekämpfung zum Ziel gesetzt hat und von dem über 12 Millionen Menschen profitieren. In diesem Programm erhält eine bedürftige Familie umgerechnet ca. 35.00 € im Monat. Pro Kind kommen noch einmal an die 15.00 € hinzu, wenn sein regelmäßiger Schulbesuch nachgewiesen werden kann.
Ein weiterer Grund für die rückläufige Mobilisierung dürften die enttäuschten Erwartungen vieler Familien sein. Bestand beim Amtsantritt Lulas noch eine gewisse Euphorie in Bezug auf die Realisierung der Agrarreform, wich diese Hoffnung in den Folgejahren der Ernüchterung. Viele Landarbeiter wandten sich frustriert ab, zogen aus ihren Landlosenlagern (Acampamentos) wieder zurück in die Stadt. Sie wollten nicht länger – manche Acampamentos existieren fünf bis sechs Jahre – entlang der Straße mit ungewissem Ausgang ausharren.
Eine realistischer Einschätzung zeigt, dass – und hier ist der Bezug zu Europa vorhanden – die kleinbäuerliche Landwirtschaft nur als „Nischenlandwirtschaft“ eine Überlebenschance hat. Die Landflucht geht weiter. Laut IBGE-Bericht 2010 leben 84,4 % der Brasilianerinnen und Brasilianer in den Städten, die Basis für die Landlosenbewegungen wie MST wird dünner, die Realisierung einer Agrarreform rückt in weite Ferne. Ein Blick auf die ersten Monate der neuen Regierung unter Dilma Rousseff bestätigt dies. Bereits im Wahlkampf war eine Agrarreform für sie kein Thema, und bei ihrem Amtsantritt am 1.1.2011 verwies sie lediglich darauf, dass kleinbäuerliche Familienbetriebe nicht im Widerspruch zu einer Unterstützung für die großer Agrarfirmen stünden. Ihre Entscheidung zugunsten der exportorientierten Landwirtschaft scheint also bereits gefallen.{mospagebreak}
Daran ändern auch die verschiedenen Programme für die bestehenden assentamentos nichts. Die Situation ist immer noch oftmals so prekär, dass die Landlosenbewegung eine energischere Umsetzung der sich gut anhörenden Programme wie Luz para Todos (Licht für alle), Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf – Programm für erleichterte Kreditmöglichkeiten usw.), Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera – Programm für Alphabetisierung, Ausbildungskurse etc.) einfordert. Mit der Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) schuf die Regierung darüber hinaus ein Instrument, um gerade Kleinbauernfamilien einen gerechteren Preis für ihre Produkte zu garantieren. Als eine der angebotenen Möglichkeiten gibt es die Unterstützung bei der Direktvermarktung, wodurch die Zwischenhändler ausgeschlossen werden und so eine Steigerung des Lebensstandards bei den Kleinbauern möglich ist. Viele der bestehenden assentamentos mit ihren ca. 300.000 Familien benötigen außerdem dringend eine verstärkte technische Unterstützung sowie eine Verbesserung ihrer Infrastruktur. Alle diese schönen Programme des Staates täuschen jedoch nicht darüber hinweg, dass der Staat bedeutend mehr finanzielle Mittel in die Agroindustrie als in die kleinbäuerliche Landwirtschaft steckt.
Es ist noch ein weiter Weg
Letztlich bleibt der Landlosenbewegung nichts anderes übrig, als mit Besetzungen, Gedenktagen, öffentlichen Aktionen immer wieder auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. So geschah es auch 2010, als in einer Art Volksentscheid eine Initiative aus verschiedensten sozialen Bewegungen (Campanha do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo (FNRA) gestartet wurde, um die Landproblematik ins öffentliche Bewusstsein zu tragen. An dieser bundesweiten Kampagne beteiligten sich 519.623 Personen. Über 95% der Befragten sprachen sich hierbei für eine Größenbegrenzung des Landbesitzes aus. Idee war es, die Abgeordneten in Brasília dazu zu bewegen, diese Forderung in die Verfassung aufzunehmen. Selbst mit dieser aufwendigen Aktion gelang es nur mäßig, ein Interesse in der Öffentlichkeit zu erreichen, die Übergabe der Unterschriften nahm auch nur ein Vertreter von Staatspräsidentin Dilma Rousseff entgegen.
Für MST-Koordinator João Pedro Stédile ist zur Zeit die vordringlichste Aufgabe, für die ca. 70 Landbesetzungen, eine Lösung zu finden. Die etwa 100.000 Familien kampieren meist einfach am Straßenrand. „Sie erdulden alle möglichen Arten von Schwierigkeiten, wir brauchen eine sofortige Lösung.“ Von der neuen Regierung Rousseff fordert er eine Stärkung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Sollte sich in diesem Bereich nichts bewegen, könne es gut sein, dass eine erneute Mobilisierung der betroffenen Familien gelingt, diese ihre Stimme lauter erheben.
Bündnisse sind notwendig
Die Zeit spektakulärer Landbesetzungen scheint aber vorbei. Innerhalb des MST weiß man, dass es weiter darüber hinausgehen muss: „Der Erwerb eines Stückes Land bedeutet nicht die Lösung des Problems. Eine Familie benötigt Kredite, ein Haus, eine Infrastruktur. Um eine Gesellschaft zu verändern, sind Erziehung und Kultur fundamental. Besetzungen lösen nicht das Problem der Agrarreform“, so MST-Führungsmitglied Gilmar Mauro. Eine stärkere Anbindung der Assentamentos an die jeweiligen Gemeinden – wie dies beim Assentamento Ipanema gelang – ist nach seiner Meinung notwendig, Bündnisse seien wichtig.
Dringend erforderlich sei zudem eine gesellschaftliche Debatte über den Einsatz von Chemie bei der Produktion von Lebensmitteln, es gelte die Gesellschaft zu sensibilisieren. Ganz aufgeben will jedoch Mauro das Ziel, das am Anfang der Landlosenbewegung stand, nicht: „Die Realisierung einer Agrarreform hängt von Veränderungen der Machtstrukturen im Land ab.“ Diese sind allerdings derzeit nicht in Sicht.
Nr. 143-2011 Sommer