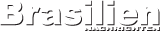Landlosenbewegung MST wird 40 Jahre alt
Was im europäisch geprägten Süden Brasiliens vor 40 Jahren begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer inzwischen in fast ganz Brasilien vertretenen Bewegung.
Konfrontation mit dem Agrobusiness unvermeidbar Günther Schulz
Was im europäisch geprägten Süden Brasiliens vor 40 Jahren begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer inzwischen in fast ganz Brasilien vertretenen Bewegung. Die Landlosenbewegung Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST ist heute die größte soziale Bewegung Brasiliens und sie ist auch Teil der über Brasilien hinausgehenden Bewegung Via Campesina.
Eine der Ursachen für die Entstehung war und ist bis heute die strukturelle Ungerechtigkeit, die ungleiche Besitzverteilung des Bodens. Ein Blick in die neuesten Erhebungen des Brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik (IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) im Jahr 2023 zeigt dies: Kleinbäuerliche Betriebe (bis zu 50 Hektar) machen 81,4 % der Landeigentümer aus, sie sind aber nur im Besitz von 12,8 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Betriebe mit mehr als 500 Hektar (Latifundien) sind in den Händen von 2,2%, sie besitzen jedoch 58,4% der Fläche. Innerhalb dieser Latifundien befinden sich 0,3% der Betriebe mit mehr als 2.500 Hektar. Hierbei handelt es sich um hochmoderne Betriebe der Agroindustrie. Sie allein machen 32,8% der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche aus (siehe auch: https://www.ibge.gov.br/apps/atlasrural/#/home). Die Fläche allein sagt noch nichts über die Macht der Agrarindustrie aus. Feststellen lässt sich jedoch, dass die Agroindustrie inzwischen den klassischen Latifundienbesitzer in seiner Bedeutung abgelöst hat.
Die schreiende Ungerechtigkeit in Bezug auf die Verteilung der landwirtschaftlichen Fläche und die soziale Not bei weiten Teilen der Bevölkerung bewirkten, dass sich kirchliche Kreise während der Militärdiktatur (1964-1985) aktiv gegen das bestehende Unrechtssystem auf dem Lande wehrten und begannen, Landarbeiterinnen und Landarbeiter zu mobilisieren. Es kam zur Gründung der kirchlichen, ökumenisch aufgebauten Landarbeiterpastoral, der Comissão Pastoral da Terra (CPT). Die Landfrage wurde thematisiert, erste spontane Landbesetzungen folgten. Es sollte der Verdienst der entstehenden Landlosenbewegung MST werden, einer breiten Bevölkerung die Sichtbarmachung der sozialen Ungerechtigkeit und die daraus resultierenden Landkonflikte in das Bewusstsein zu bringen.
Rückblick: Beginn im Süden
Die ersten Besetzungen fanden im Bundesstaat Rio Grande do Sul statt. Kleinbauern besetzten Ländereien wie die Fazendas Macali und Brilhante bei Ronda Alta im Jahre 1979. Im Dezember 1980 folgten weitere Besetzungen bei Encruzilhada Natalino. Sowohl die katholische Kirche als auch die lokale Bevölkerung unterstützten die Familien, und diese Besetzungen gelten als Ausgangsbasis für das Entstehen der Landlosenbewegung MST. Die Brasilieninitiative Freiburg e.V., gegründet 1978, unterstützte bereits damals diese Aktionen durch den Kauf von schwarzen Plastikplanen für die mit Hölzern errichtete provisorischen Unterkünfte. Außerdem half sie bei der Versorgung mit Lebensmitteln. In der Folgezeit vertieften sich die Kontakte.
„Diese Siedler versuchten ganz konkret zu überleben, sie dachten sicher nicht daran, was daraus werden würde. Encruzilhada Natalino hat dazu geführt, dass man begann, sich über den Kampf für die Agrarreform Gedanken zu machen und zu überlegen, wie dies politisch durchzusetzen sei“, betont Ceres Hadich von der nationalen Koordination der MST im Gespräch im Februar 2024 mit der Zeitung Brasil de Fato.
Aus diesen ersten Besetzungen entstand in der Folgezeit eine Bewegung, die über das kirchlich geprägte Milieu hinausgehen sollte, obwohl viele der führenden MST-Leute aus dem Bereich der Basisgemeinden der katholischen Kirche kamen. Der Mitbegründer von MST und bis heute eine der führenden Persönlichkeiten, João Pedro Stédile, entstammt diesem Umfeld. Als Sohn von Kleinbauern 1953 in Lagoa Vermelha in Rio Grande do Sul geboren, erlebte er von klein auf den alltäglichen Kampf und beschloss sehr früh sich zu engagieren.
Das Ausbleiben einer überfälligen Agrarreform führte 1984 zum ersten Nationalen Treffen der Landlosenvertretung. In Cascavel im Bundesstaat Paraná fand die offizielle Gründung der Landlosenbewegung MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - statt. Die ungefähr einhundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer dachten wohl nicht daran, dass 40 Jahre später dies der Grundstein für eine der größten sozialen Bewegungen in Lateinamerika sein würde.
Von Beginn an sah man in der Besetzung von unproduktivem Land die Möglichkeit, auf die Lage von Millionen Kleinbauern aufmerksam machen zu können. Das Ende der Militärdiktatur im Jahre 1985 schürte neue Hoffnungen, und tatsächlich sollte in der Verfassung von 1988 ein Passus Eingang finden, der eine Enteignung von Land vorsieht. Eine Agrarreform aus sozialem Interesse soll möglich sein. Vorgesehen hierfür war ungenutztes, unproduktives Land, das gegen Entschädigung enteignet werden soll. Das war auch eine Reaktion der Politik auf den ersten Nationalen Kongress der Landlosenbewegung im Jahre 1985.
Erster Nationaler Kongress 1985
Man traf sich im Januar 1985 und das Ergebnis war für die folgenden Jahrzehnte richtungsweisend. Neben Kundgebungen und Protestmärschen wurden auch Landbesetzungen als legitimes Mittel zur Durchführung der Forderungen beschlossen. Es gelang innerhalb kurzer Zeit, Familien für diese Idee zu gewinnen, und Monate später beteiligten sich 2.500 Familien an 12 Besetzungen von unproduktiven Ländereien im Bundesstaat Santa Catarina. Als großes, damals noch ein utopisch erscheinendes Ziel proklamierten die Landlosen die nationale Ausweitung, die Verwirklichung einer Agrarreform und die Überwindung des neoliberalen Wirtschaftssystems.
Gewalt prägt Auseinandersetzungen
Von Beginn an kam es zu Zusammenstößen mit Großgrundbesitzern und der staatlichen Gewalt. Großgrundbesitzer heuerten zum „Schutz“ ihres Gebietes „Sicherheitspersonal“ an, darunter nicht selten auch „Pistoleiros“, deren Aufgabe es war, Kleinbauern, auch unter Androhung von Gewalt, einzuschüchtern. Seit 1985 registriert die Landarbeiterpastoral CPT die Landkonflikte. Nach ihren Angaben kam es 2023 zu einem neuen Höchstwert an Gewaltanwendungen. 2.203 Landkonflikte mit einunddreißig Tötungsdelikten an vor allem Landarbeiterinnen und Landarbeitern, aber auch vierzehn Angehörigen von indigenen Völkern wurden erfasst. Hauptverantwortlich hierfür sind neben Großgrundbesitzern und Geschäftsleuten auch immer wieder Regierungsstellen, die sich einer Umsetzung der Agrarreform in den Weg stellen und dadurch zu illegalen Aktionen ermuntern oder selbst massive Gewalt anwenden. Einen Höhepunkt in den gewaltsamen Auseinandersetzungen nimmt das Jahr 1996 ein.
Tragödie des 17.April 1996
Dieser Tag sollte dafür sorgen, dass die Landlosenbewegung MST national, aber auch international Beachtung fand und eine bis dahin nicht gekannte Solidarität erfuhr. Der Anlass allerdings war bestürzend.
1.500 Landlose befanden sich auf Weg nach Belém im Bundesstaat Pará. Sie waren bereits eine Woche zu Fuß unterwegs. Ihr Ziel war die staatliche, für eine Bodenreform zuständige Agrarreformbehörde INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária), um die Enteignung einer Farm zu fordern. Auf der Straße bei Eldorado do Carajás (PA) stoppten 155 Militärpolizisten ihren Marsch: Es kam zu einem Gemetzel: 21 Bauern wurden ermordet, 79 kamen, teils schwerverletzt, mit dem Leben davon.
Das Massaker von Eldorado do Carajás gab der Bewegung einen ungeheuren Schub. Dies zeigte sich ein Jahr später, als 100.000 Menschen in Brasília sich gegen die Gewalt auf dem Lande und für eine Agrarreform versammelten. Dieser „Historische MST-Marsch 1997“ erfuhr Unterstützung von breiten Kreisen der Bevölkerung. „Es war historisch. Aber es war nicht der MST, der 100.000 Menschen mobilisiert hat. Es waren nicht nur MST-Aktivisten, sondern weite Teile der Gesellschaft beteiligten sich. Und das hat die Bewegung auf eine neue Ebene gehoben", betont Gilmar Mauro von der Nationalen Koordination des MST. Für ihn war das Jahr 1997 ein Wendepunkt für die Bewegung. „Wir haben die Städte gewonnen. Vor allem die Universitäten. Viele Menschen schlossen sich der Bewegung an. Damals gab es den Slogan: 'Die Agrarreform wird auf dem Land gemacht, aber in der Stadt gewonnen'", erinnert er sich in einem Gespräch mit der Zeitschrift Brasil de Fato .
Damit war die Debatte über die Agrarreform endlich in der politischen Agenda des Landes angekommen. Der damalige Präsident Fernando Henrique Cardoso (PSDB) sah sich der Notwendigkeit ausgesetzt, ein Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Und nicht zuletzt auf Druck des MST kam es 1998 zum „Nationalen Programm für die Bildung in der Agrarreform“ (PRONERA). Seitdem haben fast 200.000 junge Kleinbauern und Kleinbäuerinnen an diesen Kursen teilgenommen.
Die wohl gewalttätigste Zeit erlebte die Bewegung in den Jahren 1995 und 2010. In dieser Zeit erreichten die Zusammenstöße zwischen Staat, Latifundien und Kleinbauernbewegung ihren Höhepunkt. 1998 und 1999 stiegen die Landbesetzungen laut CPT landesweit am stärksten an. Die Regierung reagierte und beschloss im Jahr 2000, dass besetztes Land nicht mehr für eine Enteignung in Frage kommt. Dennoch ereignen sich bis heute tödliche Auseinandersetzungen.
Während der ersten beiden Amtszeiten Lulas (2003-2010) wurden 47 Millionen Hektar in das nationale Agrarreformprogramm aufgenommen (INCRA-Daten) und 615.000 Familien wurden sesshaft, lebten in anerkannten Ansiedlungen, den „assentamentos.“ Unter der Regierung „Lula 3“ (seit 2023) fanden laut der Landarbeiterpastoral CPT im ersten Halbjahr 2023 einundsiebzig Besetzungen statt. Die Besetzungen erreichen nicht mehr die hohen Zahlen aus der Regierungszeit von Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2003). Dies ist auch der veränderten politischen Lage geschuldet, und nicht zuletzt staatliche Sozialprogramme wie „Bolsa Família“ oder „Minha Casa Minha Vida“ erschweren der Bewegung die Mobilisierung im Kampf um Land.
Die Tatsache, dass nach der erfolgreichen Besetzung das Leben in einem assentamento nicht konfliktfrei vor sich geht, belegen u.a. auch Besuche bei den Familien. Die zu Beginn einer Landbesetzung bestehende Einigkeit bei den Teilnehmenden sieht sich vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt. Kleinere Grüppchen bilden sich, Individualismus wird spürbar und immer wieder kommt es vor, dass Familien sich nicht mehr vom MST vertreten lassen möchten. Auch die Idee der kollektiven Arbeit bleibt allzuoft eine idealtypische Vorstellung. Die Familien bepflanzen das ihnen übereignete Stück Land nach ihren eigenen Vorstellungen, und so gibt es, neben der kooperativen Vermarktung, auch die vollkommen autonom arbeitenden Kleinbauern in einem assentamento.
Nicht verschwiegen darf bei einem kurzen Rückblick auch die Tatsache, dass es immer wieder auch interne Debatten über die Ausrichtung der Bewegung gab. Gerade in den 1980-er und 90-er Jahren kam es zu teils heftigen Auseinandersetzungen. Kritiker sahen eine zu autoritäre Ausrichtung, einen zu starken Zentralismus in der Leitung des MST. Auch die seit Beginn des MST vorhandene starke Verbindung mit der Arbeiterpartei (PT) führte zu Diskussionen. Manch einer hatte sich mit dem Regierungsantritt von Lula eine durchgreifende Agrarreform versprochen. Dieser jedoch sah und sieht sich der Realpolitik verpflichtet und sozialistisches Gedankengut lag und liegt ihm fern. Als guter Sozialdemokrat führte er einige Sozialreformen durch, die allerdings, wie erwähnt, für die Landlosenbewegung kontraproduktiv waren, d.h. die Mobilisierung für Landbesetzungen fiel und fällt zunehmend schwerer.
Breite Unterstützung – Verankerung in der Gesellschaft – Vielfältige Herausforderungen
Dennoch: Vier Jahrzehnte später ist die Bewegung der Landlosen in 25 Bundesstaaten organisiert. Es gibt laut dem MST 185 Kooperativen, 1.900 Vereinigungen, 120 Agrarbetriebe, etwa 400.000 sesshafte Familien. Auch mit der Eröffnung der Nationalen Schule Florestan Fernandes in Guararema im Bundesstaat São Paulo im Jahr 2005 gelang ein weiterer Entwicklungsschritt. Durch vielfältige Unterstützung in Brasilien selbst, u.a. durch den Musiker und Schriftsteller Chico Buarque und dem weltweit geschätzten Photographen Sebastião Salgado, aber auch durch internationale Unterstützung, entstand ein Bildungszentrum, in dem vielfältige Angebote unterbreitet werden und die so notwendigen Schulungen bzw. Fortbildungen stattfinden können.
40 Jahre MST stellen letztlich eine Erfolgsgeschichte dar. Niemand hätte vor vierzig Jahren mit diesen erreichten Veränderungen, die das Leben für Abertausende lebenswerter machten, gerechnet. Allerdings leben immer noch 70.000 Familien in provisorischen Lagern (acampamentos), und auch heute steht die Bewegung vor zahlreichen Herausforderungen wie der Frage, wie die nachfolgende Generation der Landbesetzerinnen und Landbesetzer weiter motiviert werden kann, sich für die Idee der Agrarreform zu engagieren. João Pedro Stédile hat dies klar erkannt: Die neue Generation hat seiner Meinung nach nicht mehr den Schwung der Vergangenheit. "Sie sind bequemer. Sie können bereits zur Universität gehen. So ist der junge Landlose bzw. der bereits in einer Ansiedlung Lebende weniger daran interessiert, sich aktiv zu betätigen." (siehe auch das Interview mit João Pedro im Anschluss).
Juli 2024
Im Juli findet anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens der 7. Nationale Kongress vom MST in Brasília statt, zu dem 15.000 Menschen erwartet werden. Seit dem letzten Nationalkongress sind zehn Jahre vergangen. Die politische Landschaft hat sich seither stark verändert und der MST muss sich auf die Zukunft einstellen. Eine Neuausrichtung, in Ansätzen schon geschehen, ist notwendig. Stand am Anfang der Slogan „Land für diejenigen, die darauf arbeiten", so hat sich der MST in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Themen wie Klimawandel, Agroökologie und damit die Frage nach der Zukunft der Landwirtschaft haben Eingang in die Agenda gefunden. Der MST mischt sich verstärkt ein und hinterfragt die Ausrichtung des bestehenden Landwirtschaftsmodells. Damit ist eine Konfrontation mit dem Agrobusiness unvermeidbar. Agroökologie ist die künftige Ausrichtung, und hierbei gilt es viel Aufklärungsarbeit in den acampamentos und assentamentos zu leisten. Dem Schulungszentrum Florestan Fernandes im Bundesstaat São Paulo kommt dabei eine entscheidende Rolle zu.
Der 7. Nationale Kongress wird die Weichen für die kommenden Jahre stellen und neben dem Schwerpunkt Agroökologie gilt es sicherlich auch, die alltägliche Lage in den assentamentos in den Blick zu nehmen, ihre Struktur muss verbessert werden. Gespannt sein darf man darauf, welche Antwort auf das Vordringen der evangelikalen Kirchen in den Ansiedlungen gefunden wird. Deren Bedeutung ist in den letzten Jahren unübersehbar und bedenklich gestiegen. So sind die Herausforderungen vielfältig und gehen über die ursprüngliche Forderung nach Land weit hinaus.
Obwohl inzwischen ein fester Bestandteil der brasilianischen Gesellschaft sieht sich die Landlosenbewegung MST immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. So versuchten Bolsonaro-Anhänger mit zweifelhaften Anklagen 2023 einen Untersuchungsausschuss gegen den MST durchzusetzen, vergebens. Ende Mai 2024 dann ein erneuter Versuch der Gegner von MST:
Ein Gesetzesvorschlag in der Abgeordnetenkammer, der landlose Familien, die sich an einer Landbesetzung beteiligen, kriminalisiert, wurde mit 336 zu 120 Stimmen angenommen. Unter anderem ist vorgesehen, diese Familien von jeglichen Sozialleistungen wie Bolsa Família auszuschließen. Jetzt hat der Senat das nächste Wort und es ist zu befürchten dass auch hier die Mehrheit zustimmt. Ein Veto von Präsident Lula hätte nur aufschiebende Wirkung und könnte letztlich ein solches Gesetz nicht verhindern. Unruhige Zeiten wären die Folge und es ist deutlich, wie wichtig die Arbeit der Landlosenbewegung MST auch in Zukunft ist.
Die große Erwartung einer radikalen Bodenreform, verknüpft mit dem ersten Amtsantritt von Lula im Jahr 2003, hat sich zwar nicht erfüllt. Aber die laut der Agrarreformbehörde INCRA seither erfolgte Ansiedlung von 794.400 Familien ist dennoch als Erfolg zu werten und wäre ohne die Landlosenbewegung MST nicht in dieser Größenordnung erfolgt.
Folgendes Kurzinterview führte Günther Schulz im März mit João Pedro Stédile, Mitbegründer der Landlosenbewegung MST und bis heute einer der Führungsmitglieder.
BN: Worin siehst du die Herausforderungen für den MST in den kommenden Jahren?
Wir stehen vor vielen Herausforderungen. Zunächst müssen wir den Kampf gegen das unsägliche Latifundienmodell fortsetzen, das Kapital anhäuft und die Natur u.a. durch Bergbau und Aneignung von öffentlichem Land ausplündert. Selbst vor indigenem Land und Quilombolas (Anm: Ansiedlungen von Nachkommen ehemaliger Sklaven) wird nicht Halt gemacht.
Zweitens müssen wir dem Modell der Agrarindustrie entgegentreten, das Reichtum mit Rohstoffen produziert, die es im Bündnis mit dem internationalen Kapital und transnationalen Unternehmen ins Ausland verschickt.
Drittens müssen wir die bäuerlichen Familienbetriebe stärken, um die Natur und die Nahrungsmittelproduktion zu schützen.
Was die Lebensmittelproduktion betrifft, so müssen wir die agroökologische Landwirtschaft vorantreiben. Hierbei werden wir uns für die Produktion von agrarökologischem Saatgut, insbesondere für Getreide, Soja, Mais und Bohnen, einsetzen. Betriebe für Bio-Inputs (organische Düngemittel oder biologische Pestizide) gilt es ebenso zu errichten wie landwirtschaftliche Maschinen zu produzieren, die für Familienbetriebe geeignet sind. Auch die Solarenergie gilt es auszubauen, dies als unser Beitrag zur Energiewende.
Für die Realisierung dieser Herausforderungen benötigen wir eine sehr gute Organisation an der Basis, wissenschaftliche Erkenntnisse und eine angemessene öffentliche Politik.
BN: Der Soziologe Zander Navarro sagte am 24. Januar in der Tageszeitung Folha de São Paulo, dass die Notwendigkeit einer Agrarreform nicht mehr bestehe und dass der MST seine Aufgabe daher erfüllt habe. Was hältst du von dieser Meinung?
Jeder Intellektuelle hat das Recht zu sagen, was er will. Auch wenn es nichts mit der konkreten Realität zu tun hat. Uns stören diese Meinungen nicht. Brasilien beansprucht nur 90 Millionen Hektar für die Landwirtschaft, dagegen gibt es 130 Millionen Hektar unproduktiven Landes und 4 Millionen landlose Familien. Das ist die Realität. Der Rest ist Meinung. Wäre er der Sohn von Landlosen, hätte er sicher eine andere Meinung, aber da er Professor ist, gut verdient, zwei oder mehr Renten hat und immer Platz in den Zeitungen der Bourgeoisie findet, kann er weiterhin denken, was er will, aber er wird nichts dazu beitragen, die konkreten Probleme der Armen Brasiliens bzw. die eklatante soziale Ungleichheit zu lösen. Diese Situation hat Brasilien zusammen mit Südafrika zu den beiden ungerechtesten Gesellschaften gemacht.
BN: Wie siehst du die Bedeutung der internationalen Solidarität heute?
Der Kapitalismus hat sich globalisiert. Transnationale Unternehmen, von denen viele europäischen Ursprungs sind, beherrschen die Landwirtschaft in der ganzen Welt. Die Arbeiterklasse und die Bauern müssen daher zunehmend international vernetzt sein.
Daher die Bedeutung der internationalen Bauernorganisation Via Campesina, der Internationalen Versammlung der Völker, des Weltfrauenmarsches und der vielen internationalen Organisationen, die internationale Solidarität artikulieren und praktizieren. Dies ist ein Teil unserer Bewegung, und es ist eine Notwendigkeit, um der Krise des Kapitalismus und der Gier des amerikanischen Imperiums mit seiner Offensive in Kriegen und Konflikten, die nur einen Markt für die Kriegsindustrie wollen, entgegentreten zu können.
BrasilienNachrichten 169/2024