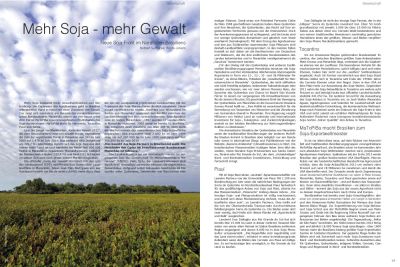Mehr Soja, mehr Gewalt - Neue Soja-Front im Nordosten Brasiliens
Mehr Soja bedeutet mehr Gewaltverbrechen und Vertreibung. Die Expansion des Agrobusiness geht in Brasilien offensichtlich Hand in Hand mit einer Zunahme von Gewalt. Das zeigt sich zumindest am Beispiel des nordostbrasilianischen Bundesstaates Maranhão, einem der vier neuen unter dem Kürzel MaToPiBa zusammengefassten Frontstaaten des Soja-Agrobusiness: MaToPiBa steht für Maranhão, Tocantins, Piauí und Bahia.
Laut der jüngst veröffentlichten „Karte der Gewalt 2012“, die vom Gesundheitsministerium erstellt wurde, explodierte die Zahl der registrierten Morde in Maranhão von 344 im Jahr 2000 auf 1.478 im Jahr 2010. Das bedeutet eine Steigerung um 329,7 % . Gleichzeitig eignete sich das Soja-Business dort immer mehr Land an und wandelte bis heute fast 600.000 Hektar in Maranhão in Sojabohnen-Monokulturen um. Lediglich die Bundesstaaten Bahia (332,4 %) und Pará (332 %) hatten im selben Zeitraum noch etwas höhere Mordanstiegsraten.
Die offizielle „Karte der Gewalt“ korreliert mit den von der Landpastoral (CPT) veröffentlichten Daten über Landkonflikte in Maranhão. Sávio José Dias Rodrigues von der Bundesuniversität von Rio de Janeiro (UFRJ) meint dazu, dass die von der Landpastoral registrierten Landkonflikte mit der Expansion der Soja-Monokulturen deutlich zunahmen. Seine jüngst veröffentlichte Studie „Konflikte und Widerstand im Sertão von Maranhão“ analysiert den Konflikt zwischen der Landbevölkerung und dem voranschreitenden Soja-Agrobusiness im Süden Maranhãos: „1997 wurden 17 Landkonflikte in Maranhão registriert. 2005 waren es bereits 91 Konflikte.“ Das entspricht einer Zunahme von über 400 %. Dem steht die Wachstumsrate der maranhensischen Soja-Anbaufläche gegenüber: Von insgesamt rund 2.600 ha im Jahr 1990 stieg sie auf 280.000 ha im Jahr 2000 und dann auf fast
500.000 ha im Jahr 2010.
„Das Gesicht des Soja-Farmers in Brasilien ist weiß. Die Hautfarbe der Opfer im brasilianischen Bundesstaat Maranhão ist schwarz.“
Die Landrechtssituation sei dramatisch, warnte im vergangenen Jahr die „Gesellschaft für Menschenrechte in Maranhão“ (SMDH). Viele Opfer der Landvertreibungen sind Nachfahren ehemaliger schwarzer Sklaven, die sogenannten Quilombolas. Aufgrund seiner kolonialen Geschichte ist Maranhão voller Quilombos, Gemeinden von Nachfahren ehemaliger Sklaven. Dank eines von Präsident Fernando Collor de Melo 1988 geschaffenen Gesetzes haben diese Quilombos und ihre Bewohner, die Quilombolas, das Recht auf ihre angestammten Territorien genauso wie die Ureinwohner. Doch der Anerkennungsprozess ist schleppend, und bis heute sind nur wenige Quilombos demarkiert und gänzlich vom Staat anerkannt (homologisiert). Mit dem Einzug des Agrobusiness und den aus Südbrasilien stammenden Soja-Pflanzern sind deshalb Landkonflikte vorprogrammiert. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um die Nachkommen von Deutschen und Italienern, die die drei südlichsten Bundesstaaten des Landes kolonisierten und in Maranhão verallgemeinernd als „Gauchos“ bezeichnet werden.
„Für den Dialog mit den Quilombolas und anderen traditionellen Bevölkerungsgruppen Maranhãos benutzen die Soja-Fazendeiros und ihre Verbündeten üblicherweise überzeugende Argumente in Form von 12-, 22-, 32- und 38-Millimeter-Patronen“, so Zema Ribeiro, Präsident der „Gesellschaft für Menschenrechte in Maranhão“. Quilombolas, die nicht stillhalten und nicht freiwillig aufgeben, bekommen Todesdrohungen oder werden erschossen, wie vor zwei Jahren Flaviano Neto, der Sprecher des Quilombos von Charco im Bezirk São Vicente Férrer. In einem zur vergangenen UN-Umweltkonferenz von Rio de Janeiro (Rio plus 20) geschriebenen Brief der Bewegung der Quilombolas von Maranhão an die Gouverneurin Roseana Sarney Murad heißt es: „Ihre Politik ist verantwortlich für die Vertreibung von Tausenden von Menschen und die Zerstörung von Gemeinden überall in Maranhão. Ihre Regierung vergibt Millionen von Hektar Land an nationale und internationale Investoren für Soja-, Eukalyptus- und Zuckerrohrplantagen, anstatt es der lokalen Bevölkerung zur Nahrungsmittelproduktion zu überlassen.“
Die dramatische Situation der Quilombolas von Maranhão sowie der traditionellen Bevölkerungen der anderen MaToPiBa-Staaten kommt in Brasilien aber lediglich nur am Rande oder sowie in alternativen Blogs und Publikationen wie der Website „Racismo Ambiental“ (Umweltrassismus) zu Wort. Die brasilianischen Massenmedien huldigen lieber dem Bild des weißen, meist blonden Soja-Produzenten aus Santa Catarina, Paraná oder Rio Grande do Sul, der dem „rückständigen“ Nord- und Nordostbrasilien Investitionen, Entwicklung und Fortschritt bringt.
Piauí
Mit im Soja-Boot sitzen „neutrale“ Agrarwissenschaftler wie Leandro Pacheco von der Universität von Piauí. Mit 1.200 mm Niederschlag pro Jahr seien die natürlichen Bedingungen der Serra do Quilombo im Nordostbundesstaat Piauí fantastisch für den großflächigen Anbau von Soja und Mais, zitierte ihn das Massenmedium „Meionorte“ Anfang dieses Jahres. „Die heutige Soja- und Maisproduktion ist völlig mechanisiert, und damit sich diese Mechanisierung rechnet, muss die Anbaufläche eben sein“, so Leandro Pacheco. Dies treffe auf die von der Überlandstraße Transcerrado durchschnittene Tafelbergregion Serra do Quilombo zu. Die Böden seien dort zwar sandig, doch ließe sich dieses Manko mit „Agrartechnik und Kalk“ ausgleichen.
Landwirt Ivar Dallaglio aus Rio Grande do Sul hat sich bereits fast 15.000 ha Land in dieser mehrere Tausend Kilometer von seiner alten Heimat im Süden Brasiliens entfernten Region angeeignet und davon 8.000 ha in eine Soja-Monokultur umgewandelt. „Die Regenfälle sind regelmäßig und das Land extrem eben“, erläutert er seine Investitionsgründe. Außerdem seien die Böden des Cerrado von Piauí am billigsten. Es sei heutzutage fast unmöglich, in Rio Grande do Sul Land zu kaufen.
Ivar Dallaglio ist nicht der einzige Soja-Farmer, der in der „billigen“ Serra do Quilombo investiert hat. Über 50 Großgrundbesitzer mit jeweils 1.000 bis über 10.000 ha Fläche haben aus dieser einst von Cerrado-Wald bestandenen und von seinen traditionellen Bewohnern nachhaltig genutzten Hochebene eines der größten, Wasser und Böden vergiftenden Soja-Meere Nordostbrasiliens gemacht.
Tocantins
Im zur Amazonas-Region gehörenden Bundesstaat Tocantins, der zwischen Brasiliens größten Soja-Anbaustaaten Mato Grosso und Maranhão liegt, verbreitet sich die Sojabohne ebenso wie ein Lauffeuer. Die besonderen Vorteile für die mechanisierten Monokulturen, sprich billiges Land und weite Ebenen, haben hier nicht nur die „weißen“ Südbrasilianer angelockt. Auch US-Farmer vornehmlich aus dem Soja-Staat Illinois reißen sich in Tocantins seit Ende der 1990er Jahre die Cerrado-Ebenen unter den Nagel. Denn in den USA ist kein Platz mehr zur Ausweitung des Soja-Wahns. Gegenüber 2011 nahm die Soja-Anbaufläche in Tocantins um weitere acht Prozent zu und beträgt heute laut offizieller Landwirtschaftsstatistik 441.052 ha. Ein weiterer Grund für die Ausweitung des Soja-Anbaus in Tocantins sei, so José Walter Alexandre Aguiar, Agraringenieur und Sekretär für Landwirtschaft und landwirtschaftliche Entwicklung, die kontinuierliche Weltnachfrage nach Proteinen sowie ein Einbruch der Soja-Ernte in den USA und nicht zuletzt ein erhöhter Weltmarktpreis für Soja. Außerdem förderten neue transgene krankheitsresistente Soja-Sorten „hoher Qualität“ den Anbau in Tocantins.
MaToPiBa macht Brasilien zum Soja-Exportweltmeister
Es ist vor allem diese neue, auf dem Rücken von Artenvielfalt und traditionellen Bevölkerungsgruppen vorangetriebene MaToPiBa-Agrarfront, die Brasilien schon im kommenden Jahr zum absoluten Soja-Weltmeister machen wird, prophezeien Agrobusiness-Analysten. Spätestens mit der Ernte 2013 werde Brasilien den großen Konkurrenten USA überflügeln. Marcos Rubin von der landwirtschaftlichen Beraterfirma Agroconsult schätzt, dass die Soja-Anbaufläche 2013 um weitere zehn Prozent auf rund 28 Millionen ha zunehmen und damit die USA übertreffen wird. Der Zuwachs werde durch Zugewinnung neuer landwirtschaftlicher Nutzflächen vor allem in Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Tocantins und Piauí geschehen sowie auf Kosten von Baumwollflächen - und auf Kosten des Steuerzahlers. Denn ohne staatliche Investitionen - vor allem in Straßen und Häfen - kommt das Soja aus der neuen Agrarfront nicht zu dessen Hauptverbrauchern nach China und Europa.
Nordbrasilien hat bereits zwei Soja-Umschlaghäfen: den einst von Greenpeace kritisierten Hafen von Cargill in Santarém und den Amazonas-Hafen Itacoatiara bei Manaus des Soja-Barons Blairo Maggi. Zur Exportförderung von Soja-Bohnen und Soja-Schrot aus der MaToPiBA-Region sowie aus Mato Grosso und Goiás hat die Regierung Dilma Rousseff nun vergangenen Februar den Bau eines weiteren Soja-Hafens am Amazonas bei Belém angekündigt. Die Tageszeitung „Folha de São Paulo“ berichtete, der Hafen könne bereits 2014 fertig sein und jährlich 18.000 Tonnen Soja umschlagen - über 1000 Tonnen mehr als Brasiliens bislang größter Soja-Exporthafen Santos im Südosten Brasiliens. Der geplante Mega-Hafen bei Bélem wird mit Sicherheit noch mehr Soja-Investoren nach Nord- und Nordostbrasilien locken. Schlechte Aussichten also für Quilombos, Quilombolas, indigene Völker, Cerrado, Caatinga und Regenwald in Nord- und Nordostbrasilien.
Ausgabe 146/2012