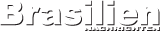Das glücklichste Volk - Sieben Jahre bei den Pirahã-Indianern am Amazonas
Daniel Everett, . DVA. 2010. 24.95 €
Daniel Everett geht 1977 mit seiner Familie in den Amazonas mit der Intention, Indigene zu missionieren. Er ist dafür ausgebildet, linguistische Forschung zu betreiben, um später die Bibel in diese indigene Sprache zu übersetzen.
Seine Forschungen und Veröffentlichungen in Bezug auf die Sprache der Pirahã haben in der wissenschaftlichen Welt für Aufsehen gesorgt und erhielten weltweit Anerkennung.
Die Sprache der Pirahã kennt weder Vergangenheit noch Zukunft, keine Fantasiegeschichten, kennt nur einfache Zahlwörter und auch Nebensätze sind nicht bekannt. Von daher ist es für einen Missionar unmöglich eine Geschichte, wie die des Jesus von Nazareth einem Stamm nahe zubringen, der fiktive Geschichten nicht begreifen kann.
Everett beschreibt anschaulich seine verschiedenen Anwesenheiten bei den Pirahã. So musste er seinen ersten Aufenthalt abbrechen, weil Frau und Tochter an Malaria erkrankten, er dies nicht erkannte und tagelang über den Fluss zur nächsten Niederlassung fuhr, um ärztliche Hilfe zu holen. Einen gewissen Hochmut trägt auch die Schilderung, wie er mit Dosen und Konserven und weiteren zivilisatorischen Gegenständen in das Dorf der Pirahã einzieht.
Ich gebe zu, ich las das Buch mit sehr viel Skepsis, vor allem was der linguistischen Absicht zu Grunde lag. Das Summer Institut of Linguistics (SIL), welches Everett in den Amazonas sandte, ist als evangelikale Missionsorganisation in Lateinamerika nicht gern gesehen. Erst werden durch nordamerikanische (oder europäische) Firmen auf indigenem Gebiet Bodenschätze entdeckt, dann erscheint das SIL zur Untergrabung der indigenen Sprache und Kultur unter dem Deckmantel der Klassifikation und Katalogisierung eben dieser Sprache. Und schließlich kommen Bulldozer zum Straßenbau und der Ausbeutung der Ressourcen und die Besiedlung durch Nicht-Indigene beginnt. Vor allem in Zeiten der Militärdiktaturen war dies nicht nur in Brasilien eine gängige Praxis.
Überrascht hat mich zum Einen die vorurteilsfreie Betrachtung der indigenen Lebensweise und damit einhergehend auch die leichte Ironie in der Darstellung des us-amerikanischen Lebensstiles in Amazonien. Und zum Anderen der Schluss: Der, der die Indianer bekehren wollte, wurde von diesen bekehrt. Das was für Everett wichtig war, nämlich sein Glaube, konnte er mit den Pirahã nicht teilen, weil der für sie nicht wichtig war. Da jedoch er die Pirahã sehr schätzte und auch deren Argumentation verstand, blieb ihm nur noch der Weg in den Atheismus und damit den der Trennung von seiner Herkunft, von seiner Familie, von seiner Welt.